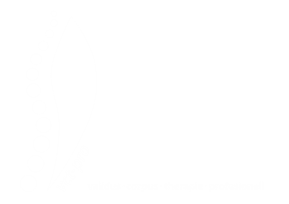Amputationen
Eine Amputation ist eine vollständige Entfernung eines Körperteils mit dem Absetzen der Extremität auf Höhe des betroffenen Knochens und ist oft die letzte medizinische Option [1]. Es ist ein irreversibler operativer Eingriff, welcher Betroffene schlagartig vor neue Herausforderungen stellt. Amputationen sind eine unausgesprochene Tatsache, welche als Merkmal für die Gesellschaft sofort sichtbar sind und sich daher von anderen Erkrankungen abheben. „In Deutschland werden pro Jahr etwa 61.000 Amputationen durchgeführt.“ [2]. Somit wächst der Kreis an Betroffenen jährlich, was mit einem Zuwachs von circa 0,1 % der deutschen Bevölkerung gleichzusetzen ist. Trotz dessen existiert in Deutschland kein Amputationsregister, weshalb die Statistiken stark schwanken. Die Ursachen sind vielseitig. Wesentliche Amputationsgründe sind in 87 % der Fälle Diabetes mellitus und periphere arterielle Verschlusserkrankungen [2].
Quellen:
[1]Jüptner und Sonnenberg, „Die Amputation“. 2016. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bmab.de/amputation/?v=3a52f3c22ed6
[2]I. Matthes, M. Beirau, A. Ekkernkamp, und G. Matthes, „Amputation und Prothesenversorgung der unteren Extremität“, Unfallchirurg, Bd. 118, Nr. 6, S. 535–548, Juni 2015, doi: 10.1007/s00113-015-0015-x.
Aktualität
Die Aktualität von Amputationen
Die internationale Organisation OECD verglich die Amputationsraten von 21 Ländern von 2000 bis 2013 und erstellt eine Rangliste, in der Deutschland den vierten Platz belegte. Zwar verbesserten sich die chirurgischen und orthopädischen Techniken in der Medizin [2], jedoch ist eine künftig steigende Tendenz für Neuamputationen prädestiniert durch den demografischen Wandel, die fortschreitende Industrialisierung und die Zunahme der Volkskrankheiten. Des Weiteren herrschen globale Konflikte, wobei jüngst der Krieg in der Ukraine oder im Gazastreifen zu erwähnen ist, was zu einer steigenden Tendenz an „Kriegsverletzungen“ führen könnte.
Quellen:
[2]I. Matthes, M. Beirau, A. Ekkernkamp, und G. Matthes, „Amputation und Prothesenversorgung der unteren Extremität“, Unfallchirurg, Bd. 118, Nr. 6, S. 535–548, Juni 2015, doi: 10.1007/s00113-015-0015-x.
Forschung
Der Forschungsstand im Bereich Amputationen.
Der Bereich der Amputationen ist im Vergleich zu anderen medizinischen Gebieten unterrepräsentiert. Innerhalb einer Literaturrecherche auf PubMed wurden zum Thema Amputation rund 60.000 Studienergebnisse gefunden. Für Amputationen der unteren Extremität wurden circa 20.000 Ergebnisse entdeckt, wobei sich mit dem zusätzlichen Kontext der Rehabilitation die Resultate auf fast 4.000 verkleinert haben. Erst mit dem Stichwort der Leitlinie reduzierten sich die Zahlen deutlich auf rund 200 Studien. Weitergehend wurden nur 39 Artikel gefunden, welche sich spezifischer mit der Thematik Leitlinie für die Rehabilitation bei Amputationen der unteren Extremität befassen. Die Mehrzahl an Studienergebnissen beschäftigen sich mit den Folgen und präventiven Leitlinien von PAVK und Diabetes mellitus, anstatt mit dem Kerngebiet der Amputationen selbst. Nach der Extraktion dieser Literatur konnten acht leitlinienorientierte Studien gefunden werden, welche sich mit nationalen sowie internationalen Leitlinien für Amputationen der unteren Extremität befassen. [Stand der Literatur bezieht sich auf 2023]
Versorgung
Die Versorgung nach einer Amputation
Die Versorgung von Amputierten erfolgt mithilfe von unterschiedlichen Professuren und ist oft mit einer lebenslangen Nachsorge gekoppelt [3]. Neben der frühzeitigen Amputationsplanung und den Operationsdetails sind die Art der prothetischen Versorgung, der Mobilitätsgrad und die Ansprüche des Betroffenen festzuhalten und abzuwägen [2]. Eine gezielte Nachbetreuung ist unerlässlich, wobei der Schlüsselpunkt der Genesung die Rehabilitation ist. Erstrebenswert ist das Sicherstellen der höchstmöglichen Lebensqualität auf Ebene der Aktivität und Partizipation, wobei die Anwendung medizinischer Leitlinien zielführend ist. Die Unvollständigkeit an Fallzahlen und Statistiken führt zu einem defizitären Abschätzen der aktuellen Therapie- sowie Versorgungslage in Deutschland [1].
Quellen:
[1]Jüptner und Sonnenberg, „Die Amputation“. 2016. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bmab.de/amputation/?v=3a52f3c22ed6
[2]I. Matthes, M. Beirau, A. Ekkernkamp, und G. Matthes, „Amputation und Prothesenversorgung der unteren Extremität“, Unfallchirurg, Bd. 118, Nr. 6, S. 535–548, Juni 2015, doi: 10.1007/s00113-015-0015-x.
[3]K. Glapa, J. Wolke, R. Hoffmann, und B. Greitemann, „[Rehabilitation following the amputation of an extremity]“, Orthopade, Bd. 50, Nr. 11, S. 900–909, Nov. 2021, doi: 10.1007/s00132-021-04173-x.
Rehabilitation
Die Rehabilitation nach einer Amputation
Die Rehabilitation von amputierten Patient*Innen stellt eine komplexe und interdisziplinäre Herausforderung dar [3]. Generell zielt die Rehabilitation darauf ab, durch eine koordinierte Kombination von Maßnahmen, die Funktionen zu verbessern und die Eigenaktivität zu fördern, um die Teilhabe der Betroffenen in allen Lebensbereichen wieder zu maximieren [4]. Angesichts eines fehlenden Amputationsregisters in Deutschland [5] wird die Anzahl der jährlichen rehabilitationspflichtigen Patient*Innen mit einer Amputation auf 16.000 - 18.000 geschätzt [3]. Daher ist es aufgrund mangelnder statistischer Daten schwierig zu bestimmen, wie viele Patient*Innen tatsächlich rehabilitative Maßnahmen erhalten haben [3]. Rehabilitation ist unabdingbar, um die körperlichen und geistigen Fähigkeiten von Menschen mit einer Amputation zu verbessern [6]. Angemessene und evidenzbasierte Rehabilitationsansätze für spezifische Amputationsgruppen können einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität der betroffenen Patient*Innen haben und zu einer nachhaltigen Verbesserung führen [6], [7], [8]. Mein persönliches Hauptaugenmerk liegt auf der Rehabilitation von Menschen mit einer Amputation an der unteren Extremität, daher werden die folgenden Beiträge dieses Thema genauer beleuchten.
Quellen:
[3]K. Glapa, J. Wolke, R. Hoffmann, und B. Greitemann, „[Rehabilitation following the amputation of an extremity]“, Orthopade, Bd. 50, Nr. 11, S. 900–909, Nov. 2021, doi: 10.1007/s00132-021-04173-x.
[4]WHO, Disability prevention and rehabilitation. in Technical Report Series 668. Geneva: World Health Organization, 1981.
[5]D. Karbe, „Versorgung von Menschen nach Amputation“, Heilberufe, Bd. 72, Nr. 12, S. 16–19, Dez. 2020, doi: 10.1007/s00058-020-1889-8.
[6]S. Turner, A. Belsi, und A. H. McGregor, „Issues faced by people with amputation(s) during lower limb prosthetic rehabilitation: A thematic analysis“, Prosthet. Orthot. Int., Bd. 46, Nr. 1, S. 61–67, Feb. 2022, doi: 10.1097/PXR.0000000000000070.
[7]G. O. Enweluzo, C. N. Asoegwu, A. G. U. Ohadugha, und O. I. Udechukwu, „Quality of Life and Life after Amputation among Amputees in Lagos, Nigeria“, J. West Afr. Coll. Surg., Bd. 13, Nr. 3, S. 71–76, 2023, doi: 10.4103/jwas.jwas_28_23.
[8]Ö. Ülger, T. Yıldırım Şahan, und S. E. Çelik, „A systematic literature review of physiotherapy and rehabilitation approaches to lower-limb amputation“, Physiother. Theory Pract., Bd. 34, Nr. 11, S. 821–834, Nov. 2018, doi: 10.1080/09593985.2018.1425938.
Leitlinien
Leitlinien für die Versorgung von Amputationen
Eine Leitlinie ist eine systematisch entwickelte, wissenschaftlich begründete und praxisorientierte Entscheidungshilfe für die angemessene Vorgehensweise bei speziellen gesundheitlichen Problemen [9]. Es stellt eine Orientierungshilfe für medizinisches Personal dar, wobei in besonderen Fällen abgewichen werden kann oder muss [10]. Leitlinien können je nach Art Ihrer Erstellung in unterschiedliche qualitative Stufen eingeteilt werden. Die Bezeichnung reichen von S1 (Handlungsempfehlungen von Expert*Innen), über S2K (konsensbasiert) und S2E (evidenzbasiert), bis hin zu S3 (konsens- und evidenzbasiert) [10].
Viele Länder haben die Relevanz dieses Themas erkannt und beschäftigen sich derzeit mit der Ausarbeitung einer Leitlinie für die Behandlung von Amputationen. Neben der Niederlande und Korea arbeitet auch Kolumbien an einer evidenzbasierten und klinischen Praxisleitlinie für Amputierte der unteren Extremität [11], [12], [13]. So wie Amerika und England, hat auch Deutschland bereits eine Leitlinie entwickelt [14], [15], [16], [17]. Innerhalb von Deutschland wurde 2019 von der AWMF eine Leitlinie für ein spezielles Rehabilitationskonzept für Amputationen veröffentlicht. Es handelt sich um die S2K-Leitlinie für die Rehabilitation nach Majoramputationen an der unteren Extremität [18], welche konsensbasiert durch ein repräsentatives Gremium erstellt wurde [10]. An der unteren Extremität kann in sogenannten Major- und Minoramputationen differenziert werden. Diese werden durch eine Trennlinie auf Höhe des oberen Sprunggelenkes voneinander abgegrenzt, weshalb sich die S2K-Leitlinie mit Amputationen proximal des Sprunggelenkes beschäftigt [1].
Die Qualität von Leitlinien ist für die klinische Praxis wichtig. So können beispielsweise evidenzbasierte und qualitative Empfehlungen für die Behandlung und Nachsorge von Amputierten kontrolliert vermittelt werden. Ein flächendeckender Einsatz vermeidet den Einsatz von überholten Maßnahmen und Qualitätsschwankungen innerhalb der Versorgung. Die Behandlung von Amputierten kann unter Berücksichtigung von wissenschaftlichen Erkenntnissen an die Bedürfnisse der Patient*Innen angepasst werden.
Quellen:
[1]Jüptner und Sonnenberg, „Die Amputation“. 2016. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bmab.de/amputation/?v=3a52f3c22ed6
[9]„Leitlinien“. Zugegriffen: 1. März 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/l/leitlinien
[10]„Leitliniengrundlagen“, Leitlinien.de. Zugegriffen: 1. März 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.leitlinien.de/hintergrund/leitliniengrundlagen
[11]J. Geertzen u. a., „Dutch evidence-based guidelines for amputation and prosthetics of the lower extremity: Amputation surgery and postoperative management. Part 1“, Prosthet. Orthot. Int., Bd. 39, Nr. 5, S. 351, Okt. 2015, doi: 10.1177/0309364614541460.
[12]H.-C. Kim, J.-S. Kim, K.-H. Lee, H. S. Lee, E.-S. Choi, und J.-Y. Yu, „Development of Korean Academy of Medical Sciences Guideline Rating the Physical Impairment: Lower Extremities“, J. Korean Med. Sci., Bd. 24, Nr. Suppl 2, S. S299, 2009, doi: 10.3346/jkms.2009.24.S2.S299.
[13]D. F. Patiño-Lugo u. a., „Implementation of the clinical practice guideline for individuals with amputations in Colombia: a qualitative study on perceived barriers and facilitators“, BMC Health Serv. Res., Bd. 20, Nr. 1, S. 538, Juni 2020, doi: 10.1186/s12913-020-05406-z.
[14]„033-044l_S2k_Rehabilitation_Majoramputation-untere_Extremitaet_2019-09_01.pdf“. Zugegriffen: 1. März 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/033-044l_S2k_Rehabilitation_Majoramputation-untere_Extremitaet_2019-09_01.pdf
[15]C. B. K. Potter und M. J. Bosse, „American Academy of Orthopaedic Surgeons Clinical Practice Guideline Summary for Limb Salvage or Early Amputation“, J. Am. Acad. Orthop. Surg., Bd. 29, Nr. 13, S. e628–e634, Juli 2021, doi: 10.5435/JAAOS-D-20-00188.
[16]„Overview | Rehabilitation after traumatic injury | Guidance | NICE“. Zugegriffen: 1. März 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nice.org.uk/guidance/ng211
[17]J. B. Webster, A. Crunkhorn, J. Sall, M. J. Highsmith, A. Pruziner, und B. J. Randolph, „Clinical Practice Guidelines for the Rehabilitation of Lower Limb Amputation: An Update from the Department of Veterans Affairs and Department of Defense“, Am. J. Phys. Med. Rehabil., Bd. 98, Nr. 9, S. 820, Sep. 2019, doi: 10.1097/PHM.0000000000001213.
[18]Greitemann et al., „Leitlinie eines speziellen Rehabilitationskonzeptes. Rehabilitation nach Majoramputation an der unteren Extremität (proximal des Fußes)“. AWMF, 2019. [Online]. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/033-044l_S2k_Rehabilitation_Majoramputation-untere_Extremitaet_2019-09_01.pdf
leitlinien in der Physiotherapie
Die leitlinienunterstütze Physiotherapie bei Amputationen an der unteren Extremität
Die S2K-Leitlinie für Majoramputationen an der unteren Extremität beschäftigt sich mit der Rehabilitation und führt unter dem Gliederungspunkt „7 Rehabilitationsteam“ den Fachbereich der Physiotherapie an [18]. Innerhalb der Leitlinie wird die physiotherapeutische Behandlung von Menschen mit einer Amputati-on auf einer halben A4-Seite umrissen. Eine erweiterte Betrachtung der physiotherapeutischen Kompetenzen könnte die Bereiche physikalische Therapie und Sporttherapie einschließen. Dennoch sind die Darstellungen in der Leitlinie für das umfassendere physiotherapeutische Management bei der Versorgung von Amputierten begrenzt. Innerhalb der Leitlinie werden folgende therapeutische Empfehlungen aus den Bereichen Physiotherapie, Sporttherapie und physikalische Therapie genannt, jedoch ohne weitere Vertiefungen:
Alltagstraining, berufliche Reintegration, Behandlung von Verspannungen und Verhärtungen, Bürstungen, Durchblutungsförderung, Elektrotherapie (EMS), Gangtraining, Kontrakturprophylaxe und Kontrakturbehandlung, Kraft-, Gefäß- und Kreislauftraining, Massagetherapie, muskuläre Pflege, Pneumonieprophylaxe, Prothesenhandling und Prothesentraining, Ödemreduktion und Manuelle Lymphdrainage, Schmerztherapie von Stumpf- und Phantomschmerzen, Stumpfkonditionierung, Sturz- und Aufstehtraining, Thermotherapie, Training sportlicher Aktivität (mit Prothese)
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich mich intensiv mit der der Anwendung und Adhärenz der S2K-Leitlinie für Majoramputationen an der unteren Extremität in der Physiotherapie beschäftigt [19]. Die physiotherapeutische Versorgung unterliegt einem grundlegenden Ablaufprozess zwischen Therapeut*Innen und Patient*Innen, welcher bei der Befundung beginnt und mit der Evaluation endet.
Der Aspekt der Befundung wird in der Leitlinie nicht explizit genannt. Lesende können jedoch aus verschiedenen Abschnitten die relevanten Informationen zusammenstellen. Es wird empfohlen, die Teilhabe und Partizipation bei der Befundung zu berücksichtigen und auf das ICF-Modell innerhalb der Leitlinie zu verweisen.
Die Therapieziele werden in verschiedenen Abschnitten erläutert und treten vereinzelt in den Beschreibungen der Berufsgruppen auf. Im Abschnitt zur Physiotherapie wird zum Beispiel Folgendes zu den Therapiezielen festgehalten: „In Abhängigkeit von Amputationshöhe, Rehabilitationsphase und Belastbarkeit des Amputierten stehen unterschiedliche Ziele im Vordergrund.“[18]. Was genau diese unterschiedlichen Therapieziele sind, wird jedoch nicht näher erläutert. Die Formulierung von allgemeingültigen Therapiezielen ist nachvollziehbar und angemessen, aber eine Ergänzung um berufsspezifische Ziele wäre empfehlenswert.
Die Therapie in der Physiotherapie wird in der Leitlinie in primäre und sekundäre Maßnahmen unterteilt [18].Aus der Leitlinie geht nicht hervor, in welchen Zeiträumen die Phasen eingeordnet werden können, sodass die Ergänzung von Angaben empfehlenswert ist. Anhand der Ergebnisse meiner Bachelorarbeit sollte die Physiotherapie um folgende Maßnahmen erweitert werden: Mobilisation, Dehnung, Kräftigung, Kontrakturbehandlung, Alltagstraining, Training ohne Prothese, Training der nicht betroffenen Seite, Rumpfmobilität, Koordinations- und Gleichgewichtstraining. Eine Vielzahl der genannten Interventionen wird jedoch unter den Berufsgruppen / Fachbereichen physikalische Therapie und Sporttherapie aufgeführt, anstatt in der Physiotherapie. Eine mögliche Umstrukturierung innerhalb der Leitlinie wäre daher sinnvoll.
Die Leitlinie empfiehlt tägliche Physiotherapie, tägliches Geh-/Transfer-/Terraintraining und tägliches Rollstuhl-/Prothesengebrauchstraining. Die Sporttherapie wird bedarfsadaptiert geregelt [18]. In meiner Interviewstudie wurde Physiotherapeut*Innen zu den therapeutischen Maßnahmen aus der Leitlinie befragt. Auffällig ist, dass die Maßnahmen, welche als weniger oder überhaupt nicht relevant eingeschätzt wurden, überwiegend passive Interventionen sind. Ein Großteil der Maßnahmen aus der physikalischen Therapie und Massage weisen laut der Physiotherapeut*Innen wenig oder überhaupt keine Relevanz für die Praxis auf. Aktive Maßnahmen werden hingegen von den Physiotherapeut*Innen als sehr relevant bewertet. Schwierigkeiten im Verständnis hatten die Physiotherapeut*Innen mit der Stumpfkonditionierung. Für die Therapiemaßnahmen innerhalb der Leitlinie wird empfohlen, den Fokus auf aktive Intervention zu setzten und alle Maßnahmen mit entsprechender evidenter Wirkung zu versehen.
Larson untersuchte die Wirkung von Massagetherapie bei Amputation der unteren Extremität und fand heraus, dass es zu keiner Veränderung des ambulanten Aktivitätsniveaus der Betroffenen führt [20]. Talbot et al. überprüften die Auswirkung neuromuskulärer Elektrostimulation auf die prothetische Rehabilitation von Amputierten. Langfristig wurde kein Unterschied zwischen den beiden Vergleichsgruppen gefunden [21]. Einfeldt et al. und Abou et al. belegen einen positiven Effekt von Übungsinterventionen und Prothesentraining auf den Gang und das Gleichgewicht bei Personen mit Amputationen der unteren Gliedmaßen [22], [23]. Ülger et al. und Gailey et al. untersuchten die Wirkung von wissenschaftlicher Evidenz zur prothetischen Rehabilitation und Physiotherapie bei Amputationen an der unteren Extremität. Sie stellten fest, dass das Training der kardiopulmonalen Ausdauer und Flexibilität, die Kräftigung von Rumpf und Beinen, das Training von Gleichgewicht und Koordination sowie Übungen zur Gewichtsbelastung und Standkontrolle positive Effekte auf die funktionelle Mobilität, die Gewichtshebekapazität mit Prothese sowie die Geh- und Gleichgewichtsfähigkeit haben [8], [24].
In verschiedenen Abschnitten der Leitlinie werden weitere Möglichkeiten zur Überprüfung wie zum Beispiel der 6-Minuten-Gehtest, der 10-Meter-Gehtest oder der Timed Up and Go Test zur Evaluation der Therapie genannt. Darüber hinaus werden Aspekte wie die allgemeine muskuläre Kraft, Koordination und Gleichgewicht zur Evaluierung empfohlen, ebenso wie Kontrollmerkmale wie das selbstständige An- und Ausziehen oder die Tragedauer der Prothese [18].Die Leitlinie empfiehlt eine Prä- sowie Postmessung zu Beginn und zum Ende der Rehabilitation. Diese Angaben stimmen mit den Erkenntnissen meiner Bachelorarbeit überein. Es ist anzumerken, dass die Angaben zu Kontroll- und Evaluationszeiträumen für Assessments einheitlich in der Leitlinie aufgeführt sein sollten.
Weiterhin ist anzumerken, dass in der Leitlinie nur an wenigen Stellen konkrete Parameter für die Therapie oder das Training genannt werden. Insbesondere im Bereich der Rehabilitation sind Trainingsmethoden wie Kraftausdauer und Hypertrophie als besonders geeignet anzusehen und sollten in die Leitlinie integriert werden. Eine systematische Übersichtsarbeit von Rosario et al. zeigt einen positiven Effekt von Krafttraining auf den Muskelaufbau, die Haltung, das Gleichgewicht und das Gangmuster. Es wird empfohlen, ein Krafttraining zwei bis dreimal pro Woche mit ein bis drei Sätzen bei zwölf bis 15 Wiederholungen durchzuführen [25]. Des Weiteren wird das Thema Patient*Innen-Edukation für die Berufsgruppe der Physiotherapie als relevant erachtet und sollte in die Leitlinie integriert werden. Die Behandlung und Therapie mit der Prothese in der Physiotherapie ist ebenfalls ein relevanter Punkt, der in die Leitlinie aufgenommen werden sollte.
Quellen:
[8]Ö. Ülger, T. Yıldırım Şahan, und S. E. Çelik, „A systematic literature review of physiotherapy and rehabilitation approaches to lower-limb amputation“, Physiother. Theory Pract., Bd. 34, Nr. 11, S. 821–834, Nov. 2018, doi: 10.1080/09593985.2018.1425938.
[18]Greitemann et al., „Leitlinie eines speziellen Rehabilitationskonzeptes. Rehabilitation nach Majoramputation an der unteren Extremität (proximal des Fußes)“. AWMF, 2019. [Online]. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/033-044l_S2k_Rehabilitation_Majoramputation-untere_Extremitaet_2019-09_01.pdf
[19]K. Schimske, „Anwendung und Adhärenz der S2K-Leitlinie für Majoramputationen an der unteren Extremität“. Bachelorarbeit an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg im Studiengang Therapiewissenschaften, 2023.
[20]E. R. Larson, „Massage therapy effects in a long-term prosthetic user with fibular hemimelia“, J. Bodyw. Mov. Ther., Bd. 19, Nr. 2, S. 261–267, Apr. 2015, doi: 10.1016/j.jbmt.2014.04.005.
[21]L. A. Talbot, E. Brede, und E. J. Metter, „Effects of Adding Neuromuscular Electrical Stimulation to Traditional Military Amputee Rehabilitation“, Mil. Med., Bd. 182, Nr. 1, S. e1528–e1535, Jan. 2017, doi: 10.7205/MILMED-D-16-00037.
[22]A.-K. Einfeldt, A.-K. Brinck, S. Schiller, und B. M. Borgetto, „Gangtraining nach Amputation der unteren Extremität – Ein systematisches Pyramiden-Review“, Rehabil., Bd. 61, Nr. 06, S. 373–382, Dez. 2022, doi: 10.1055/a-1719-3801.
[23]L. Abou, A. Fliflet, L. Zhao, Y. Du, und L. Rice, „The Effectiveness of Exercise Interventions to Improve Gait and Balance in Individuals with Lower Limb Amputations: A Systematic Review and Meta-analysis“, Clin. Rehabil., Bd. 36, Nr. 7, S. 857–872, Juli 2022, doi: 10.1177/02692155221086204.
[24]R. Gailey, I. Gaunaurd, M. Raya, N. Kirk-Sanchez, L. M. Prieto-Sanchez, und K. Roach, „Effectiveness of an Evidence-Based Amputee Rehabilitation Program: A Pilot Randomized Controlled Trial“, Phys. Ther., Bd. 100, Nr. 5, S. 773–787, Mai 2020, doi: 10.1093/ptj/pzaa008.
[25]M. L. V. V. Rosario u. a., „Effects of Resistance Training in Individuals with Lower Limb Amputation: A Systematic Review“, J. Funct. Morphol. Kinesiol., Bd. 8, Nr. 1, S. 23, Feb. 2023, doi: 10.3390/jfmk8010023.
REHA-Programm
Ein evidenzbasiertes Rehabilitationsprogramm für Personen mit einer Amputation an der unteren Extremität.
Die Studie von Gailey et al., 2020 [24] beschäftigt sich mit dem Evidence Based Amputee Rehabilitation Program, kurz EBAR-Programm, bei Patient*Innen mit einer Unterschenkelamputation (TTA). Die Autor*Innen untersuchten die Wirksamkeit eines evidenzbasierten Rehabilitationsprogramms bei Menschen mit einseitiger TTA hinsichtlich der Aktivitätsbeeinträchtigung. Das Ziel der Studie war es, festzustellen, ob das EBAR-Programm mit einem gezielteren Übungsansatz die funktionelle Mobilität von Patientinnen und Patienten, die bereits eine Physiotherapie und prothetische Schulung erhalten hatten, verbessert. Die randomisierte und einfach verblindete klinische Pilotstudie vergleicht ein achtwöchiges Rehabilitationsprogramm in der Interventionsgruppe mit einer Kontrollgruppe. Die Ergebnisse wurden anhand des Amputee Mobility Predictors (AMP) und des 6-Minuten-Geh-Tests gemessen. Das EBAR-Programm zeigte bei der Interventionsgruppe eine statistische als auch klinisch signifikante Verbesserung der Mobilität, während die Kontrollgruppe keine Veränderungen verzeichnete. Fast 60 % der Teilnehmenden der EBAR-Gruppe erreichten ein höheres Mobilitätslevel im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Obwohl die Stichprobengröße klein war, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Menschen mit TTA von dem EBAR-Programm mit einem gezielteren Übungsansatz profitieren können und es zu einer Verbesserung der prothetischen Mobilität auf Aktivitätsebene führen kann.
Das EBAR-Programm umfasst acht Wochen und besteht aus drei Trainingseinheiten pro Woche, jeweils 60 Minuten lang. Es hat drei Bereiche: ein 15-minütiges kardiopulmonales Aufwärmprogramm, ein 10-minütiges Flexibilitätsprogramm und ein 35-minütiges individuelles Übungsprogramm. Das Aufwärmprogramm besteht aus verschiedenen Übungen und Trainingsgeräte, die alle zwei Wochen intensiviert werden. In den ersten beiden Wochen wird das Training mit dem Oberkörper-Ergometer durchgeführt. In Woche 3 und 4 erfolgt das Training auf dem 4000 Nu-Step Recumbent Cross Trainer, wobei sowohl die obere Extremität, die untere Extremität als auch der Rumpf trainiert werden. In Woche 5 und 6 wird die elliptische Maschine für das Training genutzt. Schließlich wird in Woche 7 und 8 das Training durch Laufbandgehen durchgeführt. Das Flexibilitätsprogramm für die Beine, Becken und Rumpf wird in den ersten beiden Wochen von den Physiotherapeut*Innen vorgegebenen und ab der dritten Woche selbstständig von den Patient*Innen durchgeführt wird. Das individuelle Trainingsprogramm beinhaltet fünf Komponenten: Rumpf- und Beinkräftigung, Gleichgewicht und Koordination, Gewichtsbelastung und Haltungskontrolle sowie Training im Umgang mit der Prothese. Die verhältnismäßige Auslastung der einzelnen Komponenten wird durch den AMP bestimmt. Erreichen Teilnehmende in einer AMP-Aufgabe nicht den maximalen Wert, wird ein Trainingsbedarf abgeleitet. Hierbei stehen Übung mit einer Bewertung von Null im Vordergrund des Trainings. Die Übungsinhalte werden basierend auf der Bewertung der AMP-Aufgaben durch das Fachwissen der Physiotherapeut*Innen aufbereitet. Die Übungen werden alle zwei Wochen entsprechend einer Neubewertung des AMP angepasst oder intensiviert. Der AMP ist ein Messinstrument, der die funktionellen Fähigkeiten sowie die Mobilität mit und ohne Prothese beurteilt (AMPPro und AMPnoPro). Die Bewertung erfolgt anhand von Mobilitätsleveln, auch K-Level genannt (K0 bis K4). Aufgrund seiner kurzen Anwendungsdauer (10-15 Minuten), der überschaubaren Ausrüstung und der unkomplizierten Bewertung (Skala von 0 bis 2) ist der AMP besonders gut für den Einsatz in der Physiotherapie geeignet [26]. Zudem weist er eine hohe Retest-Reliabilität (r=0.96), Interrater- Reliabilität (r=0.99) und Interrater-Reliabilität (r=0.97) auf und steht in starker Korrelation mit dem 6-Minuten-Geh-Test (r=0.78) [26].
Das von Gailey et al., 2020 entwickelte EBAR-Programm fokussiert sich auf die Mobilität, welche als einer der wichtigsten Prädiktoren für die Lebensqualität von Menschen mit einer Amputation ist [27]. Die Studienergebnisse haben gezeigt, dass qualifizierte Physiotherapie auf der Ebene von Aktivität und Partizipation notwendig ist, um die prothetische Mobilität zu verbessern. Die physiotherapeutische Praxis kann von den Inhalten des EBAR-Programms profitieren und die Erkenntnisse in bestehende rehabilitative Programme einfließen lassen. Anzumerken ist jedoch, dass der Bedarf an evidenzbasierten Studien zu Rehabilitationsansätzen, die speziell auf verschiedene Amputationsgruppen zugeschnitten sind, hoch ist. Um die Lebensqualität von Amputierten langfristig zu verbessern sind aussagekräftige Studien mit größerer Stichprobengröße, höher statischer Aussagekraft und vermehrter methodischer Transparenz erforderlich [7], [8].
Quellen:
[7]G. O. Enweluzo, C. N. Asoegwu, A. G. U. Ohadugha, und O. I. Udechukwu, „Quality of Life and Life after Amputation among Amputees in Lagos, Nigeria“, J. West Afr. Coll. Surg., Bd. 13, Nr. 3, S. 71–76, 2023, doi: 10.4103/jwas.jwas_28_23.
[8]Ö. Ülger, T. Yıldırım Şahan, und S. E. Çelik, „A systematic literature review of physiotherapy and rehabilitation approaches to lower-limb amputation“, Physiother. Theory Pract., Bd. 34, Nr. 11, S. 821–834, Nov. 2018, doi: 10.1080/09593985.2018.1425938.
[24]R. Gailey, I. Gaunaurd, M. Raya, N. Kirk-Sanchez, L. M. Prieto-Sanchez, und K. Roach, „Effectiveness of an Evidence-Based Amputee Rehabilitation Program: A Pilot Randomized Controlled Trial“, Phys. Ther., Bd. 100, Nr. 5, S. 773–787, Mai 2020, doi: 10.1093/ptj/pzaa008.
[26]R. S. Gailey u. a., „The amputee mobility predictor: an instrument to assess determinants of the lower-limb amputee’s ability to ambulate“, Arch. Phys. Med. Rehabil., Bd. 83, Nr. 5, S. 613–627, Mai 2002, doi: 10.1053/apmr.2002.32309.
[27]S. Z. Fatima, „Life of an amputee: predictors of quality of life after lower limb amputation“, Wien. Med. Wochenschr. 1946, Bd. 173, Nr. 13–14, S. 329–333, Okt. 2023, doi: 10.1007/s10354-022-00980-9.